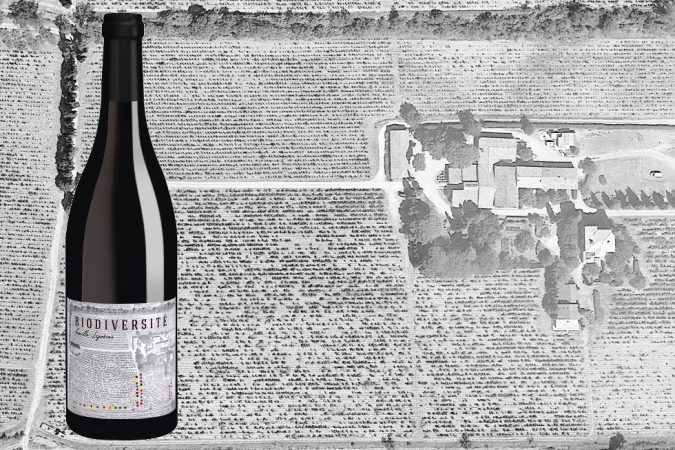Anfang Jahr hat Delinat-Gründer Karl Schefer in einem WeinLese-Artikel ein klares Bekenntnis zum Korken «als besten und nachhaltigsten» Verschluss für Weinflaschen abgelegt und dieses ausführlich begründet. Für den Delinat-Chef ist klar, dass ein qualitativ hochwertiger Naturkorken im Vergleich zum Aluminium-Drehverschluss oder zu Plastik- und Glaszapfen die beste Ökobilanz aufweist. Diese wird noch besser, wenn die Korken recycelt und wiederverwertet werden.

Kork mehrfach nutzen
Das ist leider sowohl in Deutschland wie auch in der Schweiz noch zu wenig der Fall. Als Weingeniesser haben wir es in der Hand, diese Bilanz aufzupolieren und möglichst viele Naturkorken der Wiederverwertung zuzuführen, denn für eine einmalige Nutzung als Flaschenverschluss ist dieses wertvolle Naturprodukt definitiv zu schade.
In beiden Ländern gibt es Anlaufstellen, die sich für ein rationelles Sammeln und Wiederverwerten von Korken einsetzen. So hat sich der Landesverband Hamburg des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) mit der KORKampagne zum Ziel gesetzt, möglichst viele der 1,2 Milliarden Flaschenkorken, die jährlich in Deutschland anfallen, als ökologisch wertvolles Dämmgranulat für den Hausbau zu verwenden. Beim NABU Hamburg erfährt man, wo die nächstgelegene Sammelstelle ist und wie man sogar selbst zur Sammelstelle werden kann. Mit dem Erlös aus dem Dämmgranulatverkauf unterstützt der NABU Kranichschutzprojekte in Spanien und Deutschland.
In der Schweiz sorgt das Fachhaus dafür, dass die Korkzapfen an den über das ganze Land verteilten Sammelstellen abgeholt und für die Weiterverwertung bereitgestellt werden. Das gewonnene Korkgranulat wird für Hohlraumisolation, Zuschlagstoff für Bodenmatten und Lehmbausteine und anderes verwendet. Im Jahr 2015 wurden so rund 20 Tonnen Korkzapfen gesammelt und wiederverwertet. Das sind erst 5 Prozent der gesamthaft anfallenden Menge. Zu den vielen Korksammelstellen der Schweiz gehören auch die Delinat-Weindepots in Basel, Bern, Olten, St. Gallen und Winterthur sowie der Weinshop in Zürich. Es können hier ausschliesslich Naturkorken zurückgegeben werden, wie sie Delinat für ihre Weine verwendet. Eine Liste der Schweizer Sammelstellen finden Sie hier auf einer interaktiven Karte. Wer keine Sammelstelle in der Nähe hat, kann die Korken per Post ans Fachhaus nach Dübendorf senden.
Basteln mit Kork
Kreative Köpfe können Korken auch selber weiterverwerten. Googlen Sie einfach mal nach «Basteln mit Kork». Da gibt es geniale Ideen. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. Falls Sie nicht selber basteln wollen, fragen Sie bei Schulen oder Kindergärten nach, ob diese Ihre Korken haben möchten.
Wir freuen uns, wenn Sie dem «besten und nachhaltigsten» Flaschenverschluss die Treue halten und dafür sorgen, dass dieser nicht einfach im Hausmüll landet.