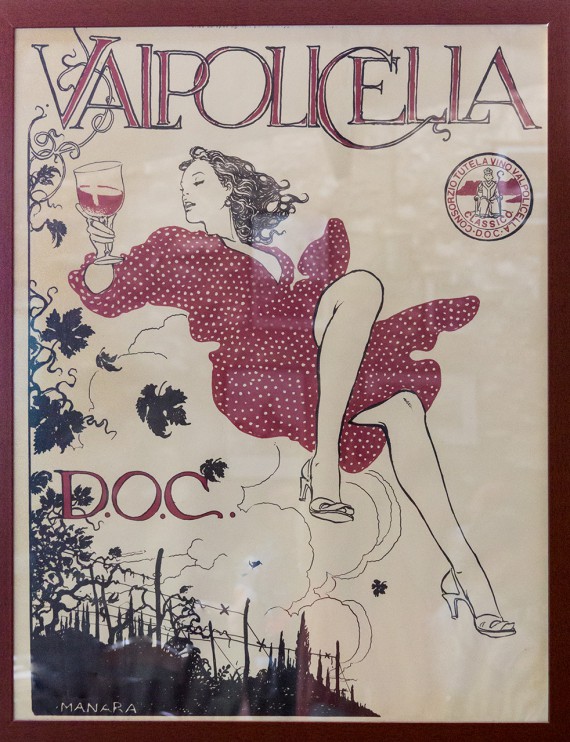Weinfehler sind lästig, oft kostspielig und sie können gar rufschädigend sein. Doch manche Fehler werden vom Weintrinker kaum erkannt – oder aber als besondere Note geschätzt. Manchmal sind die Grenzen zwischen Weinfehler und Eigenart des Weines fliessend, und nicht jede Nase und jeder Gaumen reagiert gleich. Wie entstehen diese Makel – und woran erkennt man sie?

Ein durchschnittlicher Weingeniesser schüttet in seinem Leben wohl Wein für mehrere Tausend Euro in den Abfluss: verdorben durch Korkengeruch. Noch deutlich mehr Weine sind nur schwach damit belastet, sodass der Fehler nicht erkannt wird, die fehlende Frische und Frucht jedoch auffallen: «Der war auch schon besser.» Ein Stoff namens 2,4,6-Trichloranisol, kurz TCA, verursacht diesen muffig-modrigen Geruch. Kleinste Mengen sind hochwirksam: Ein Tausendstel Gramm TCA in einem See, so gross wie ein Fussballfeld und einen Meter tief, lässt den ganzen See nach Korken schmecken.
Korkengeruch ist der häufigste Weinfehler. Erstaunlicherweise gibt es regelmässig Wein trinkende Menschen, die einwenden, sie hätten in ihrem ganzen Leben noch nie einen Korkenfehler festgestellt. Können Nasen diesen muffig-modrigen Ton ignorieren? Der Fehlton ist auch am Gaumen feststellbar, bei mit Wasser verdünntem Wein gar noch stärker. Als Ursache kommen unter anderem Schimmelpilze und Chlor in Reinigungsmitteln infrage.
Müffelt ein Wein, so kann das auch von einem schlecht gereinigten Fass oder unsauberen Abfüllschläuchen herrühren: durchaus möglich also, dass auch Weine mit Drehverschluss «korkeln»! Ähnlich auch der Geruch von Schimmelpilz, anzutreffen in unsauberen und defekten Betontanks. Solche Pannen schaden natürlich dem Ruf eines Weinguts.
Ebenfalls durch unsorgfältiges Arbeiten im Keller können Bakterien, Hefen und Restzucker in der Flasche zu einer Nachgärung führen. Kribbeln am Gaumen, Kohlensäureperlen im Glas oder gar eine Trübung des Weines sind die Folgen. Anders die bewusste Zufuhr von Kohlensäure vor dem Füllen, die dem Weisswein Frische verleihen soll.
Salatsauce und Uhukleber
Es gibt noch eine Reihe anderer Übel, welche den Genuss schmälern, die Haltbarkeit verringern oder den Wein gar ungeniessbar machen. Sie entlarven sich meist durch einen eigenartigen Duft, den jedoch nicht alle als unangenehm empfinden. Beispiel Essigstich, das heisst flüchtige Säure: Ein Fachmann erkennt den Fehler bereits ab einer Konzentration von 0,6 g/l. Doch viele mögen den Duft italienischer Salatsauce sogar im Rotwein. Essigsäurebakterien gelangen schon im Weinberg auf die Trauben, etwa bei Verletzungen der Beerenhaut durch Wespenfrass, Hagel oder bei der Ernte. Auch angefaulte Beeren und mangelnde Hygiene im Keller können bewirken, dass während oder nach der alkoholischen Gärung flüchtige Säure (Essigstich) entsteht.
Ebenfalls auf Essigsäurebakterien basiert Ethylacetat: Uhu, rufen dann Leimschnüffler entzückt – für andere aber ein klarer Fehlton. Im fertigen Wein ist er heute eher selten anzutreffen, kann ihn der Kellermeister doch mittels Aktivkohle entfernen – allerdings bleiben dann auch erwünschte Aromen auf der Strecke.
Nasser Pullover
Weine werden reduktiv oder oxidativ ausgebaut; also mit möglichst wenig Luft oder mit einer dosierten Menge. Der reduktive Ausbau soll einfacheren Weinen ihre primäre Frucht und Frische bewahren, der oxidative Ausbau fördert die Aromenvielfalt. Entsprechend unterschiedlich schmecken die Weine. Statt fruchtige Frische kann einem beim Öffnen einer Flasche Rotwein aber der Mief von Verbandstoff oder gar alter Wäsche entgegenwehen. Dies gilt aber nicht als Weinfehler, der Geruch verschwindet nach dem Belüften (Dekantieren) des Weines. Stall, nasse Wolle oder gar faule Eier deuten hingegen auf einen Böckser hin. Diesen Fehler gibt es auch in den Varianten Knoblauch, Kohl oder verbrannter Gummi. Auslöser sind Luftabschluss und schwefelhaltige Substanzen. Bei zu intensivem Luftkontakt oder zu geringem Schutz mit schwefliger Säure (SO2) können sich im Wein schon früh Oxidations- oder Reifenoten entwickeln: Aromen von angeschnittenem Apfel, Rosinen oder gar Sherry. Bei einem in Würde gereiften Wein sind diese Töne hingegen normal, ja sogar erwünscht. Wohl selten sind sich Weinliebhaber so uneinig wie bei der Frage: Wann ist ein Wein alt? Bei Traditionalisten erzeugt ein gut gelagerter Grand Cru Burgunder oder eine hochklassige Riesling Spätlese Gänsehaut und leuchtende Augen. Doch Reifenoten wie Honig beim Chardonnay, Petrol beim Riesling oder Rosinen und Rumtopf bei altem Rotwein vermögen nicht jeden zu begeistern. Die Frischefruchtfraktion wittert da bloss balsamischen Mief, Tankstelle und überreifes Obst. Erst wenn sich dazu ein schaler Geschmack, ausgezehrte Gerbstoffe und eine bräunliche Farbe gesellen, bestätigen auch Traditionalisten das Ableben solcher Weine.
Diese Wahrnehmungsunterschiede kennen wir auch bei Speisen. Lammfleisch, das nach ebensolchem riecht, wird von vielen gemieden; andere mögen ihr Lamm erst, wenn es auch danach schmeckt. Bitteres Gemüse wird als gesund und ursprünglich geschätzt – oder gemieden, ebenso Bitterschokolade oder ein starker Espresso. Und Korianderblättchen schmecken je nach Gaumen herrlich exotisch – oder abscheulich, weshalb er auch Läusekraut genannt wird. Nicht jeder ist gleich empfindsam für Weinfehler, und in einem kräftigen, aromatischen Rotwein verstecken sich Fehltöne leichter als in einem filigranen Weisswein.
Holz ja – Pferd nein
Wir alle haben eine Idealvorstellung von Wein: Beispielsweise soll ein guter Rotwein nicht allzu exotische Aromen aufweisen; angenehme Fremdaromen wie Vanille, Karamell und Rauch vom Holz sind jedoch willkommen. Viele mögen eine erfrischende, jedoch nicht dominante Säure, etwas Restzucker, aber nicht zu viel bitteres Tannin. Je mehr ein Wein von diesem Idealbild abweicht, umso eher bezeichnen wir ihn als unausgewogen und schliesslich als fehlerhaft, wobei dies alles durch das individuelle Geruchs- und Geschmacksempfinden geprägt ist: abstossende Fehltöne für den einen, sortentypische Weincharakteristika für den andern. So gehört ein spürbarer Gerbstoff (Tannin) zu einem jungen Lagerwein. Grünes Tannin hingegen stammt von unreifem Traubengut, ein klarer Fehler.
Tierisch wird es, wenn der Wein nach Pferdesattel oder nassem Hund riecht. Dann sind Hefen der Sorte Brettanomyces bruxellensis im Spiel; für Fachleute kurz Brett. In dezenten Fällen wird diese Stallnote insbesondere von traditionellen Barriqueliebhabern gar geschätzt. Zurückzuführen sind diese animalischen Noten auf ungenügend gereinigte Geräte und schlecht gewartete Holzfässer, in denen sich Brettanomyces-Hefen einnisten, die Ethylphenole mit dem charakteristischen Duft bilden.
Weinfehler erkennen
Korkenschmecker
Geruch: muffig, modrig
Abhilfe*: keine, Verwendung als Kochwein ist für stark gewürzte Saucen sicher möglich, aber für Feinschmecker sicher nicht akzeptabel.
Fasston
Geruch: modrig
Abhilfe*: Schwacher Geruch kann evtl. durch Belüften des Weines (Dekantieren) vermindert werden.
Essigstich
Geruch: Rotweinessig
Abhilfe*: keine, doch in kleinen Dosen wird der fruchtähnliche Geruch gar geschätzt.
Reifenoten: Luft- bzw. Aldehydton, Oxidation
Geruch: angeschnittener Apfel, Dörrobst, Sherry
Geschmack: Überalterte Weine schmecken bitter und ausgezehrt.
Farbe: Ziegel- bis Braunrot bzw. bräunliches, dunkles Gelb
Abhilfe*: keine.
Animalische Noten
Geruch: Pferdesattel, Pferdeschweiss, nasser Hund, speckiganimalischer Geschmack.
Abhilfe*: keine, aber manche traditionellen Bordeaux-Trinker mögen den Geruch.
Böckser
Geruch: faule Eier, verbrannter Gummi, gekochter Spargel, Kohl, Zwiebeln, Knoblauch.
Abhilfe*: Eine Kupfermünze ins Glas oder in die Karaffe zu geben, kann helfen.
Kohlensäure
Prickelnd bis stichig am Gaumen oder sogar Kohlensäurebläschen sichtbar.
Abhilfe*: Geöffnete Flasche oder Karaffe schütteln, damit die Kohlensäure entweicht; der leicht stichige Eindruck am Gaumen aber bleibt.
*Massnahmen, um bereits in Flaschen gefüllten Wein noch zu retten