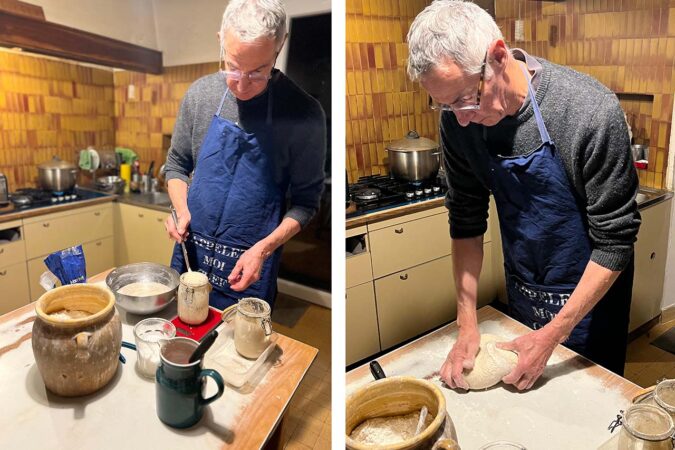Bei Albet i Noya im spanischen Penedès, der frisch gebackenen ersten Appellation, die zu hundert Prozent biologisch arbeitet, ist man gerne am Puls der Zeit. So kam es seit Herbst 2024 zur Verkostung von hunderten neuen robusten Rebsorten, die die Delinat-Winzer von Albet i Noya gemeinsam mit Züchter Valentin Blattner in jahrelanger Forschungsarbeit entwickelt und einzeln vinifiziert haben.
Vor über zehn Jahren setzten sich der Rebenzüchter Valentin Blattner und der Delinat-Winzer Josep Maria Albet i Noya ein ehrgeiziges Ziel: Sie beschlossen, neue PIWI-Sorten speziell für Spanien zu züchten. Dazu haben sie das Projekt VRIAC ins Leben gerufen: «Varietats Resistents i Autòctones Adaptades al Canvi Climàtic», also «Resistente und autochthone Rebsorten, die dem Klimawandel angepasst sind».
In den letzten Jahren ist das Pionierprojekt stetig gewachsen: Auf dem Versuchsfeld bei Albet i Noya wachsen mittlerweile über 7000 verschiedene Sorten. Jedes Jahr wählen die Experten die besten aus, um die Trauben mittels Mikrovinifikation auf ihren Geschmack zu testen. So entstanden für den Herbst 2024 beinahe 800 einzeln ausgebaute Mikrovinifikationsproben.
Unsere Produktmanager Martina Korak, David Rodriguez und Emil Hauser dabei, um Valentin Blattner und Josep Maria bei der Verkostung der neuen Sorten zu unterstützen.

Ein Degustationsgespräch
Über 800 Weine zu verkosten, das hört sich nach jeder Menge Arbeit an … Wie lief die Degustation der neu gezüchteten Sorten bei Albet i Noya genau ab?
David Rodriguez: Natürlich konnten wir nicht alle Weine verkosten, dafür fehlte uns die Zeit. Wir haben in einer Gruppe an zwei Tagen jeweils rund 50 Weissweine verkostet und bewertet.
Emil Hauser: Josep Maria Albet i Noya und der Rebenzüchter Valentin Blattner haben extern etwa 500 Weissweine und rund 300 Rotweine aus neuen PIWIRebsorten mittels Mikrovinifikation keltern lassen. Als David und ich ankamen, standen die Weissweine schon bereit für die Verkostung. Die Rotweine folgen.
Welche Eigenschaften habt ihr in den Weinen gesucht?
David: Mithilfe einer App des katalanischen Forschungszentrums VITEC hat jeder Teilnehmer alle Weine auf Typizität (Geruch, Geschmack) und Qualität (Frische, Komplexität, Tiefe, Länge) bewertet. Dazu musste angegeben werden, ob sich der Wein entweder für die Produktion von Stillwein, als Basiswein für Schaumweine eignet oder defekt und somit ungeniessbar ist.
Emil: Zusätzlich haben wir den neuen Wein mit bereits bestehenden Rebsorten verglichen, uns also gefragt, welche bekannte Rebsorte geschmacklich am nächsten liegt. Und zum Schluss sollten in einem Feld noch die Degustationsnotiz und besondere Beobachtungen zu jedem Wein eingetragen werden. Dann sandte jeder Teilnehmer seine Daten an die App ab. Die VITEC wertet diese Daten aus.
Wie stuft ihr die Qualität der Weine denn insgesamt ein?
Emil: Es war alles vorhanden, von den fehlerhaften, oxidierten Weinen über die flachen, gesichtslosen Varianten bis hin zu frischebetonten, komplexen Proben. Interessanterweise zeigten sich praktisch keine neuen Sorten von einer «eindimensionalen » Seite, wo ein bestimmtes Aroma, wie zum Beispiel Peperoni, dominiert.
David: Der Aspekt der Säure war auch immer ein Thema. Manche mögen eine sehr prägnante Säure, aber für mich ist exzessive Säure unharmonisch. Es gab auch Weissweine mit ziemlich viel Tannin, die von der Struktur her fast wie Rotwein schmeckten.
Aussergewöhnliche Bedingungen
Worin unterscheidet sich diese Degustation von einer klassischen?
David: Es ging primär darum, das mittel und langfristige Potenzial einer bestimmten Sorte zu erkennen. Aufgrund der zunehmenden Klimaerwärmung standen die Frische und die Eleganz im Vordergrund.
Emil: Die Proben erinnerten an frische, junge Tankmuster, die David und ich immer gegen Ende Jahr bei den Winzern degustieren und für unsere Assemblagen vor-selektionieren. Der wirklich fertige Wein schmeckt dann jeweils ein bisschen anders. In diesem Fall hat das Team nur sehr kleine Mengen ausgebaut.
Merkt man das auch beim Wein?
David: Ja, es wurden wirklich nur sehr kleine Mengen, also ein bis drei Liter pro Sorte, vinifiziert. Teilweise waren die Mengen so klein, dass der Wein bereits oxidiert war, zum Beispiel, wenn die Flasche aufgrund der kleinen Menge, nicht ganz gefüllt war. Emil: Zudem waren die Muster nicht geklärt oder geschönt, sie konnten also Trübungen enthalten.
Muss man andere sensorische Faktoren beachten als bei einer Degustation von klassisch ausgebauten Weinen?
David: Man muss sich auf das Wesentliche wie Frische, Aromatik, Komplexität und Länge konzentrieren. Finesse und Holzintegration sind noch nicht vorhanden. Wir müssen anders degustieren, als bei herkömmlichen Wein. Also die Faktoren, anhand derer man das Potenzial und die Komplexität eines Weines erkennen kann, sind anders.
Gab es denn wesentliche Unterschiede im Aromenspektrum gegenüber den etablierten Sorten?
Emil: Ältere PIWI-Sorten weisen manchmal markante, «eindimensionale» Aromen auf. Diese neuen Sorten zeichneten sich aber vor allem durch zitrische, gelbe und exotische Fruchtaromen aus. Und die guten Sorten hatten eine markante, gut eingebundene, aber keine schneidende Säure.
Gab es Weine, die geschmacklich an europäische Sorten erinnerten?
David: Da die Neuzüchtungen vor allem aus Kreuzungen mit den im Penedès vorhandenen Sorten stammen, konnte teilweise auch auf diese Rebsorten rückgeschlossen werden, also Xarel.lo, Macabeu und Parellada. Manche erinnerten auch an Sauvignon blanc, Verdejo und Txacolí (Anm.: säurebetonte, eher neutral schmeckende Rebsorte aus dem Baskenland).
Emil: Ich verglich die Neuzüchtungen teilweise mit mir bekannten Rebsorten aus Portugal wie zum Beispiel Arinto, Loureiro, Alvarinho und Antão Vaz.

Conclusio und weiterführende Gedanken
Waren die Urteile der Degustierenden oft homogen oder gingen die Meinungen stark auseinander?
Emil: Meistens recht homogen. Allerdings hatte Valentin Blattner ein relativ weit gefächertes Sensorium für mögliche weltweite Standorte einer neuen Sorte, und so hat er gewissen Attributen mehr oder weniger Gewicht gegeben, als wir das taten.
David: Emil und ich sind Einkäufer, und unser Fokus liegt auf der Kundenpräferenz. Winzer wie Josep Maria haben noch andere Aspekte wie zum Beispiel Erträge und Eignung für eine bestimmte Region im Hinterkopf, die sie ebenfalls berücksichtigen.
Was war das Fazit nach der Degustation, was bleibt euch in Erinnerung?
Emil: Es gibt vielversprechende Ansätze, um künftig auch in heisseren, trockeneren Gebieten frische und aromatische Rebsorten für weisse Stillweine oder Basisweine für die Schaumweinproduktion zu kultivieren. Speziell hat mich überrascht, dass die befürchtete Monodimensionalität fast gar nicht aufgetreten ist.
David: Die interessantesten Mikrovinifikationen werden jetzt weiterverfolgt. Um ein eindeutiges Urteil über das Geschmacksprofil einer neuen Sorte zu fällen, muss sie über mehrere Jahre hinweg degustiert werden. Erst dann wird sich das wahre Potenzial klarer herauskristallisieren. Zu bedenken ist auch, dass nebst dem Geschmack immer auch die Resistenz- und Wuchseigenschaften einer Sorte stimmen müssen. Erst wenn alle Faktoren einer neuen Sorte zufriedenstellend sind, kommt sie für den grossflächigen Anbau infrage. Bis man also Weine aus diesen Sorten kaufen kann, werden noch einmal ein paar Jahre vergehen.
Die Fragen stellte Olivier Geissbühler
Innovative Forschung im Weinbau: das VRIAC Projekt