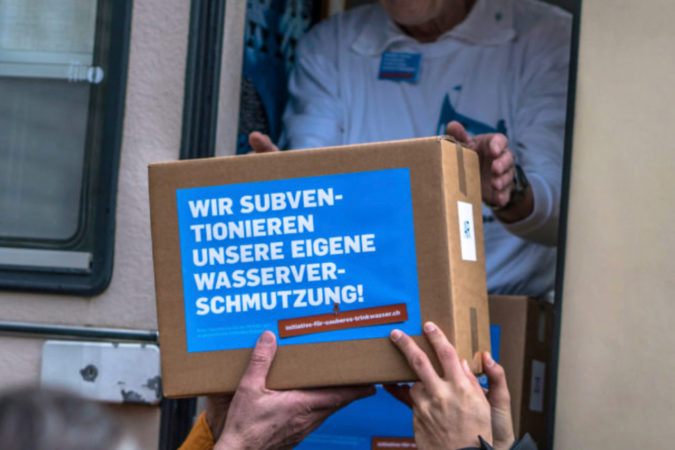In der Wachau und im angrenzenden Kremstal gehen Andreas und Maria Harm selbstbewusst und unbeirrt ihren Weg. Ihrem Ziel, in grösstmöglicher Harmonie mit der Natur Wein zu keltern, ordnen sie viel unter – nicht aber die Weinqualität. Dafür gebührt ihnen die Auszeichnung als Biodiversitätswinzer 2021.
Die Wachau ist eine berühmte, aber konservative, in alten Traditionen verhaftete österreichische Weinregion. «Im Vergleich zur gesamtösterreichischen Fläche ist der Bioanteil hier gering», sagt Andreas Harm, einer der wenigen überzeugten Wachauer Biowinzer. Doch der Wind dreht in seinem Sinn: «Es gibt auch hier immer mehr Rebbergbesitzer, die sich ökologische Vielfalt wünschen. Unserem Betrieb werden deshalb immer wieder Rebflächen zum Kauf oder zur Bewirtschaftung angeboten.» Kein Wunder, ist die Rebfläche der Familie Harm zwischen 2008 und 2020 von drei auf zwölf Hektar angewachsen. Das ermöglichte Andreas Harm vor ein paar Jahren, das elterliche Weingut mit Heurigen seinem Bruder David zu überlassen und zusammen mit seiner Frau Maria einen eigenen Betrieb aufzubauen. Beflügelt wurde diese erfreuliche Entwicklung auch durch die Zusammenarbeit mit Delinat, die mit dem Weinjahrgang 2010 begann. Andreas Harm: «Für uns ist Delinat ein äusserst bereichernder und verlässlicher Partner, der ebenso hohe ökologische Ansprüche stellt wie wir an uns selber.»

Lebendiger Boden als Basis
Andreas Harm ist promovierter Agronom, Rebbauberater und Rebbauforscher. Als ausgewiesener Bodenspezialist weiss er um die Bedeutung einer reichen Biodiversität im Rebberg. Die Basis dafür ist ein gut strukturierter, lebendiger Boden. Er ist Heimat für Milliarden unterschiedlicher Organismen. Diese Lebewesen stehen im direkten Austausch mit der Rebe und dem vielfältigen Pflanzenteppich in den Rebgassen. Wenn das System funktioniert, übernehmen Begrünungspflanzen (Leguminosen) die Funktion des Nährstofflieferanten. Mithilfe der Bodenlebewesen werden alle für die Entwicklung der Rebe notwendigen Substanzen weitergeleitet und verfügbar gemacht. «Dank dieser Interaktionen kann sich die Rebe optimal selber ernähren», erklärt Andreas Harm. So kommt es weder zu einer Überversorgung, die Krankheiten und Schädlinge fördert, noch zu einer Unterversorgung, die den Ertrag reduziert und die Qualität des Weines beeinträchtigt. «Befindet sich die Rebe in dieser Harmonie, so können sich die Trauben optimal entwickeln und reifen. Gleichzeitig werden sie widerstandsfähiger und robuster gegenüber Schädlingen und Krankheiten», so Andreas Harm.
Entscheidend für das harmonische Zusammenspiel zwischen Boden, Begrünung und Mikroorganismen ist eine dem jeweiligen Standort angepasste Vielfalt an verschiedenen Pflanzenarten. Andreas und Maria Harm gehen aber noch einen Schritt weiter: Den Platz zwischen den Reben nutzen sie da und dort auch für den Anbau von Gemüse, Kräutern und Früchten. «Ein Teil unserer Rebanlagen wird so wieder zu einem Garten der Vielfalt und des Genusses», freut sich Maria. Wer bei den Harms einmal getafelt hat, der weiss wieder, wie gut Gemüse schmecken kann.
Weisswein-Klassiker
Genauso authentisch sind auch die Weine: Das naturverbundene Winzerpaar konzentriert sich dabei auf die einheimischen Paradesorten Riesling und Grüner Veltliner, aus denen Gewächse mit typischer Frucht und feiner Mineralität gekeltert werden. Was bedeutet Andreas Harm die Auszeichnung als Biodiversitätswinzer des Jahres 2021? «Das Thema Biodiversität spielte in unserem Betrieb von Beginn an eine wichtige Rolle. Da wir selbst viel Zeit in unseren Rebbergen verbringen, erfüllt es mich immer wieder mit Freude, wenn ich dort neue Pflanzen oder Tierarten entdecken kann. Für uns ist die Auszeichnung daher eine grosse Anerkennung von Leistungen an der Natur, die normalerweise kaum beachtet werden.»
Der Wein zum Tag der biologischen Vielfalt
Jedes Jahr zum Tag der Biodiversität, für den die UNO im Jahr 2000 den 22. Mai festgelegt hat, kürt Delinat einen Biodiversitätswinzer des Jahres, der sich im Bereich der biologischen Vielfalt besonders verdient macht. Der ausgezeichnete Winzer seinerseits keltert aus diesem Anlass eine spezielle Abfüllung.
Andreas Harm hat sich für einen Grünen Veltliner entschieden. Die Trauben stammen aus der Lage Goldbühel in der Ortschaft Kruststetten im Kremstal. Sie wurden am 6. und 7. Oktober 2020 von Hand bei wunderschönem, sonnigem Wetter von einer Truppe aus Familienmitgliedern, Freunden und weiteren Helfern gelesen. Nach der Lese wurden die Trauben schonend gepresst. Der Most wurde im Stahltank spontan während zirka drei Wochen vergoren. Danach reifte der Wein bis im Januar auf der Feinhefe, ehe er Ende März auf die Flasche gezogen wurde.
So entstand ein sortentypischer Grüner Veltliner. Er zeigt eine animierende Würze nach wilden Kräutern, duftender Blütenwiese und saftigen Früchten. Am Gaumen gefällt die Balance aus delikatem Schmelz und animierender Fruchtsäure. Andreas Harm empfiehlt seinen Biodiversitätswein speziell zum klassischen Wiener Schnitzel, zu gekochtem Schulterscherzel (Rindfleisch) vom Bioweiderind mit sautiertem Gemüse, zu Gemüseflan mit Ratatouille oder zu gekochten Spargeln.
Harm Biodiversität – Grüner Veltliner
Kremstal DAC 2020
www.delinat.com/7286.20
Hier finden Sie alle Beiträge der WeinLese 62: