In keinem Zweig der Landwirtschaft werden mehr Pestizide gespritzt als im Weinbau. Auch gibt es keine Anzeichen für eine Besserung – im Gegenteil: Schädlinge passen sich erstaunlich schnell an und bilden Resistenzen, sodass immer mehr und neue Gifte notwendig werden. Dabei geraten die gefährlichen Chemikalien nicht nur in die Umwelt und verpesten Luft, Wasser und Boden, sondern sie schwächen auch die Reben zusätzlich, sodass diese noch leichter von Krankheiten befallen werden und zusätzlich geschützt werden müssen. Ein Teufelskreis.

Gärtnern und Bauern stehen grundsätzlich zwei Wege offen: Der erste versucht, Nutzpflanzen vor Feinden und Krankheiten zu schützen, sie zu ernähren, zu hegen und zu pflegen und bei jeder Gefahr zur Seite zu stehen. Das ist, was die moderne, intensive, konventionelle Landwirtschaft in unterschiedlichen Nuancen praktiziert. Der zweite Weg beschreitet das pure Gegenteil: Die Pflanze wird weitestgehend sich selbst überlassen. Auch bei Krankheiten wird nicht eingegriffen, wenn die Möglichkeit besteht, dass die Kultur sie selbst überwinden kann. Dieses Prinzip entspricht der Delinat-Methode.
Es ist ganz erstaunlich, wie sehr der konventionelle Weinbau einer Intensivstation im Spital entspricht. Mit Kunstdünger werden die Reben ernährt, wie der Kranke an der Infusion. Mit Fungiziden und Insektiziden werden die Pflanzen vor Parasiten geschützt, wie der Kranke mit Antibiotika. Mit Herbiziden werden «Unkräuter» getötet oder der Boden mit Maschinen «sauber» gehalten, um Nahrungs-, Wasser- und Mineralstoffkonkurrenz auszuschalten – beim Kranken sorgt eine keimfreie, vor Lärm und Gefahren abgeschirmte Umgebung für Sicherheit. Die Parallelen gehen noch weiter, denn sowohl die in Intensivkultur konventionell angebaute Pflanze wie auch der Kranke würden nicht überleben, wenn man Nahrung, Medikamente und Pflege einstellen würde. Allerdings denkt niemand daran, Kranke länger als notwendig intensiv zu pflegen – im Unterschied zur intensiven Landwirtschaft.
Auch Bio-Weinbau kann kritisch sein, wenn er nicht konsequent umgesetzt wird. 12 bis 18 Spritzungen mit Kupfer und Schwefel sind in einigen Regionen notwendig, um sensible Kulturen vor Mehltau und anderen Pilzen zu schützen. Da klingen die Ziele und Vorsätze des Bio-Gedankens fast schon zynisch: Gesunde Produkte aus einer heilen Welt? Weit gefehlt. Mit Kupfer belastete, von schweren Traktoren verdichtete Böden, Abbau statt Aufbau von Humus, dieselbe Monokultur, dieselben anfälligen Pflanzen wie beim konventionellen Nachbarn.
Wer wirklich Biowein herstellen will, der seinen Namen verdient, muss umdenken und mindestens diese drei Faktoren erfüllen:
 1. Säen statt düngen
1. Säen statt düngen
Verzicht auf Dünger. Es muss für eine reiche Begleitflora zwischen den Reben gesorgt werden. Damit wird Mehltau und anderen Pilzerkrankungen vorgebeugt. Die Wurzeln sind nicht «Konkurrenz» für die Reben, sondern die Grundlage für gesunde Mykorrhiza, einer Symbiose von Pflanzenwurzeln und Pilzen, die nicht nur für gute Ernährung, sondern auch für deutlich mehr Vitalität sorgen.
 2. Vielfalt statt Einfalt
2. Vielfalt statt Einfalt
Da Weinbau eine Dauerkultur ist und daher nicht wie im Gartenbau von Jahr zu Jahr eine Fruchtfolge stattfindet, muss die Umgebung um die Reben möglichst vielfältig gestaltet werden. Es braucht Büsche, Hecken, Biotope, Steinhaufen und auch Bäume in den Reben. Je grösser die Vielfalt, desto stabiler entwickelt sich das ökologische Gleichgewicht. Epidemien von Schädlingen können sich so nicht bilden, für jeden Invasor gibt es Fressfeinde. Auch die Pflanzen kommunizieren untereinander und bilden die unglaublichsten Verbindungen. Es entwickelt sich eine Art kollektive Intelligenz, die praktisch alle Gefahren zu parieren weiss.
 3. Stärken statt schwächen
3. Stärken statt schwächen
Schon allein die ersten beiden Prinzipien helfen der Pflanze, sich besser behaupten zu können. Wichtig ist aber auch, dass die Rebe robust und für Boden und Klima geeignet ist. Die Genetik spielt dabei eine entscheidende Rolle. Und hier kommen die pilzwiderstandsfähigen neuen Züchtungen ins Spiel, die sogenannten PIWIs.
PIWI – ökologisch und ökonomisch das Beste
Seit im vorletzten Jahrhundert die Reblaus und diverse Pilze aus Amerika importiert wurden, hat sich das Handwerk des Winzers völlig verändert. Pflanzenschutz ist zur Hauptbeschäftigung geworden. Die ganze Sinfonie an chemischen Bekämpfungsmitteln, die ein Jahrhundert lang über die Weinberge gespritzt worden ist, hat nicht geholfen – zu anpassungsfähig sind die Mehltau-Pilze.
Erst seit in den letzten Jahrzehnten Kreuzungen zwischen europäischen Edelreben und amerikanischen Wildreben gelangen, die eine akzeptable Weinqualität zuliessen, keimt Hoffnung für eine nachhaltige Lösung. Inzwischen ist die Züchtung viele Generationen weiter, und die Resultate übertreffen die Erwartungen. In Blinddegustationen machen PIWIs immer öfter das Rennen vor den europäischen Edelsorten.

Was aber noch toller ist: Die meisten haben eine gute Resistenz gegen Mehltau und gegen allerlei andere Übel. Auch ist eine grössere Toleranz bei Trockenheit und Frost erzielt worden. Für den Winzer bedeutet das eine schier unglaubliche Erleichterung – eine Halbierung der Arbeitszeit pro Hektar ist durchaus möglich. Wenn zusätzlich auch die Biodiversität und die Begrünung stimmen, dann ergibt sich ein Weinberg, der kaum mehr einen Traktor sieht. Meistens werden präventiv eine oder zwei Spritzungen mit Backpulver, Tinkturen oder Algenpräparaten gemacht, aber in der Regel ginge es auch ohne.
Was der Verzicht auf Pestizide, Kupfer und Schwefel ökologisch bedeutet, kann kaum in Worte gefasst werden. Es ist wie Tag und Nacht. Lockere Böden, weil die schweren Traktoren sie nicht mehr verdichten. Keine Belastung mit Pestiziden und Schwermetallen. Höherer Humusgehalt, mehr gebundenes CO2, kaum mehr Dieselverbrauch, grössere Vielfalt usw. Die Öko-Bilanz von PIWI-Parzellen ist um ein Vielfaches besser als bei Edelreben.
Nachhaltige LösungFür Delinat ist klar: In den meisten Gebieten Europas sind resistente Rebsorten Voraussetzung für konsequent ökologischen Weinbau. Inzwischen ist nicht nur eine grosse Auswahl an guten PIWIs erhältlich, auch die Gesetzeslage hat sich entschärft. In den kommenden Jahren werden daher immer mehr PIWIs das Delinat-Sortiment und die Delinat-Weinabos bereichern.
–>Hier gelangen Sie unserem Sortiment an PIWI-Weinen.
Weiterführende Informationen zum Thema PIWI finden Sie im Videoblog «Weinbau der Zukunft»
Und dass Weinbauern sich dank PIWIs wieder ihrem eigentlichen Handwerk widmen dürfen und nicht als Seuchenjäger Energie und Zeit verschwenden müssen, steigert die Motivation, aus ihrem Weinberg ein Paradies zu gestalten. Zwischen den Reben blüht es, anstelle von Traktorenlärm singen Vögel. Das allein wäre schon Belohnung genug, doch der Winzer gewinnt nicht nur Frieden und Freizeit, er hat netto deutlich mehr im Portemonnaie. Keine Pestizid-Rechnungen mehr, viel weniger Ausgaben für Maschinen, Treibstoff und Arbeitszeiten.

Grossartig, die Leistung der Züchter. Allen voran Valentin Blattner, der, von Behörden gebremst, von Forschern belächelt und von Winzerkollegen verspottet, konsequent und selbstlos im abgelegenen Schweizer Jura neue Sorten züchtet. Der weder Anerkennung noch finanzielle Entschädigung bekommen hat. Die Weinwirtschaft weltweit schuldet ihm Respekt und Dank.
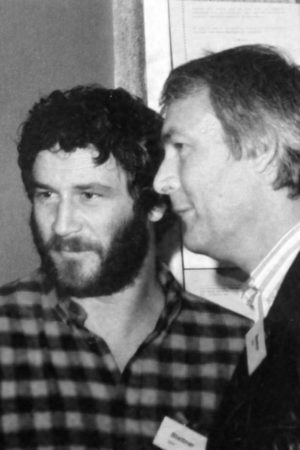 PIWI-Pionier Pierre Basler
PIWI-Pionier Pierre BaslerDr. Pierre Basler, Agronom ETH an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Obst- und Weinbau Wädenswil (heute Agroscope), setzte sich über Jahrzehnte für einen umweltschonenden Weinbau mit pilzwiderstandsfähigen Rebsorten ein. Er gilt zusammen mit Rebzüchter Valentin Blattner als Pionier in der PIWI-Forschung.
Schon 1995 hat Pierre Basler mit dem Aufbau des Sortengartens auf dem Delinat-eigenen Weingut Château Duvivier in der Provence begonnen. Ein schwieriges und waghalsiges Unterfangen, waren PIWI-Reben in Frankreich doch damals verboten. Pierre Basler konnte die Chambre d’Agriculture jedoch für eine Sondergenehmigung gewinnen, um PIWIs grossflächig auf Duvivier zu testen.
Leider wurde der inzwischen international anerkannte PIWI-Spezialist 2003 wegen einer Hirnblutung arbeitsunfähig. Zu seinem Vermächtnis gehört das im selben Jahr erschienene Buch «‹Andere› Rebsorten». Darin werden mitunter PIWI-Sorten, deren Entstehung sowie die Entwicklungstendenzen beschrieben. Das Buch wurde später von Robert Scherz überarbeitet und in einer Neuauflage unter dem Titel «PIWI-Rebsorten» herausgegeben. Es richtet sich sowohl an Fachleute wie auch an interessierte Laien und Hobbywinzer und kann auf der Website von PIWI International bestellt werden: www.piwi-international.de
Alle Artikel der WeinLese 51:




















 1. Säen statt düngen
1. Säen statt düngen 2. Vielfalt statt Einfalt
2. Vielfalt statt Einfalt 3. Stärken statt schwächen
3. Stärken statt schwächen

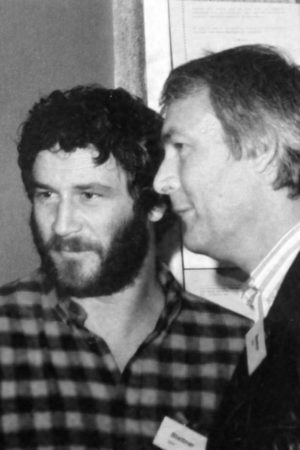 PIWI-Pionier Pierre Basler
PIWI-Pionier Pierre Basler








 Neuzüchtung aus dem Jahre 1983 durch das Staatliche Weinbauinstitut Freiburg i.Br. PIWI aus den Sorten Cabernet Sauvignon und Bronner. Sehr hohe Resistenz gegen Echten und Falschen Mehltau sowie Botrytis. Souvignier Gris ist mit einem neutralen bis leicht fruchtigen Burgunder-Typ vergleichbar. Im Duft dezente Fruchtaromen nach Honigmelone, Aprikose und Quitte. Im Geschmack zeigen sich eine fruchtige Säure und eine zarte Tanninstruktur.
Neuzüchtung aus dem Jahre 1983 durch das Staatliche Weinbauinstitut Freiburg i.Br. PIWI aus den Sorten Cabernet Sauvignon und Bronner. Sehr hohe Resistenz gegen Echten und Falschen Mehltau sowie Botrytis. Souvignier Gris ist mit einem neutralen bis leicht fruchtigen Burgunder-Typ vergleichbar. Im Duft dezente Fruchtaromen nach Honigmelone, Aprikose und Quitte. Im Geschmack zeigen sich eine fruchtige Säure und eine zarte Tanninstruktur.
 Neuzüchtung aus dem Jahre 1975 durch das Staatliche Weinbauinstitut Freiburg i.Br. aus den Sorten Merzling und Gm 6493. Sehr hohe Resistenz gegen Echten und Falschen Mehltau.
Neuzüchtung aus dem Jahre 1975 durch das Staatliche Weinbauinstitut Freiburg i.Br. aus den Sorten Merzling und Gm 6493. Sehr hohe Resistenz gegen Echten und Falschen Mehltau.