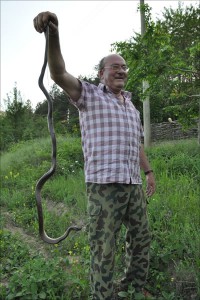Die ersten Blog-Beiträge zum neuen Delinat-Zentrallager haben Fragen aufgeworfen und auch zu Kritik geführt. Offenbar haben wir noch zu wenig informiert. Im August wird die WeinLese ausführlich darüber berichten. Vorab hier einige Antworten.
Warum nur noch ein Weinlager statt zwei?
Durch den Aufbau der dezentralen Weindepots hat das Zentrallager in der Schweiz an Bedeutung verloren. Seit 2008 ist es stetig kleiner geworden. Im EU-Raum hingegen gibt es keinen dezentralen Aufbau und das deutsche Lager ist Jahr für Jahr gewachsen. Da die beiden Lager nur 15 km auseinander lagen, war ein Zusammenzug naheliegend und dank elektronischer Verzollung heute auch mit vertretbarem Aufwand möglich.

In der Schweiz setzt Delinat auf dezentrale Auslieferung – zwar nicht mit dem Fahrrad, aber mit umweltfreundlichen Kompogas-Autos.
Was passiert mit dem Schweizer Personal?
Vom Umzug sind keine der 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen. Alle behalten ihre Arbeitsstelle an den bisherigen Standorten in Horn, St. Gallen, Olten und Bern. Und es wird ein Arbeitsplatz mit CH-Arbeitsvertrag mit Arbeitsort Weil am Rhein neu geschaffen. Nur das alte, bereits verkleinerte Zentrallager zieht um, also die Warenvorräte (siehe unten).
Ein Gebäude der hässlichen Art?
Für eine Industriezone ist das neue Gebäude im Gegenteil fast schon ein Schmuckstück. Wichtiger als Ästhetik zählt hier aber die Logistik-Infrastruktur, um mit möglichst wenig Energie eine optimale Leistung zu erzielen. Dazu gehören Bahnanschluss, Gebäudeisolation, Energiebilanz.
Hat das neue Lager Bahnanschluss?
Ja, Rhenus betreibt im Lager Weil einen grossen Güterbahnhof und unmittelbar daneben den Container-Rheinhafen. Bahnanschluss war bei der Standortwahl eines der wichtigsten Kriterien, weil Delinat immer die Bahn wählt, wenn die Strecke es ermöglicht.
Warum Standort Weil am Rhein?
Erstens ist Basel für Delinat ein idealer Knotenpunkt im Zentrum der wichtigsten Weinländer Italien, Spanien, Frankreich und den wichtigsten Kundendestinationen Schweiz und Deutschland. Dies gilt vor allem für den Schienentransport, der für Delinat eine zentrale Rolle spielt. Zweitens liegt Weil am Rhein (direkt an der Grenze) auf deutscher Seite – es fällt bei der Einlagerung kein Schweizer Zoll an. Und drittens bietet Weil mit seinen Gleis- und Schiff-Anschlüssen eine hervorragende Logistik-Infrastruktur. Übrigens liegt der neue Standort gerade mal 15 km vom alten entfernt.
Grasdach: Ein Feigenblatt?
Wer das glaubt, irrt. Warum sollte man 1000 Tonnen Erde auf einem Dach lagern und speziell verstärkte teure Stützen einbauen? Grasdächer haben zwei grosse Vorteile: Erstens isolieren sie ausgezeichnet, vor allem gegen die sommerliche Hitze. Und zweitens geben sie ein Stück Natur zurück. Bei richtiger Einsaat herrscht auf Gründächern eine erstaunliche Biodiversität. Im Unterschied zu landwirtschaftlich genutztem Land kann hier ohne Ertragsdruck Vielfalt gedeihen und ein Habitat für Insekten und Vögel werden. Googeln Sie nach „Gründach und Biodiversität“. Ein Beispiel in Zürich: bereits nach 2 Jahren wachsen 9 Pflanzen, die auf der roten Liste stehen.
Führt Delinat künftig weniger Schweizer Weine?
Im Gegenteil, das Sortiment wächst – wir werden im Herbst-Katalog mehr Schweizer Weine anbieten als je zuvor.
Was ist das «Weindepot» und was das «Zentrallager»?
Die bisherigen «Abhollager/Ladengeschäfte» in St. Gallen, Bern und Olten sind vom Umzug nicht tangiert und bleiben mit unveränderten Öffnungszeiten bestehen. Drei neue Weindepots sind in Planung. Von den 6 Standorten wird künftig regional ausgeliefert, was über 50% der Schweiz abdeckt. Das Zentrallager hat dadurch seit 2008 stetig an Bedeutung verloren und ist deutlich kleiner geworden.
Wer liefert mir an die Haustüre?
Im Einzugsgebiet der Weindepots wird Delinat zunehmend selbst ausliefern. Das hat grosse Vorteile, weil wir einen deutlich besseren Service als die Postdienste bieten können. In die Gebiete, die weiter entfernt von Weindepots liegen, läuft alles weiter wie bisher. In Deutschland wird künftig mehr per Hermes geliefert, weil dadurch ein Umpacken in spezielle Postkartons entfällt und die Bruchgefahr deutlich kleiner ist.
Wird die Lieferung in der Schweiz teurer?
Nein, im Gegenteil. Die Entwicklung der Post-Preise hätte uns schon bald zu einer Erhöhung des Portoanteils gezwungen. Dank eigenem Auslieferdienst bleibt es beim günstigen Porto.
Muss ich bei der Lieferung Zoll/MWST bezahlen?
Die Schweizer Preise enthalten Zoll und Verzollungskosten, die Flaschen-Entsorgungsgebühr und die Schweizer Mehrwertsteuer. Es ändert sich nichts gegenüber bisher.
Wie transportiert Delinat?
Auf langen Strecken wird vor allem auf der Schiene transportiert. Die Schweizer Weindepots liefern mit leichten Kompogas-Fahrzeugen aus.
Wie schnell wird geliefert?
Die Umstellung wird zu rund einem Tag schnellerer Auslieferung führen. Weindepots werden in wöchentlich festen Touren liefern. Man bekommt dann seine Sendung immer am selben Wochentag und kann sich besser darauf einrichten. Wer im „letzten Moment“ bestellt, bekommt die Sendung innerhalb von 24 Stunden.
Warum sind die Preise in der Schweiz höher?
Siehe auch oben: Zoll/MWST. Ausser diesen zwei Faktoren fallen in der Schweiz auch noch deutlich höhere Kosten für die Auslieferung an – etwa das Doppelte gegenüber Deutschland. Hingegen profitieren Schweizer von der tiefen MWST. Das macht sich vor allem bei den höherpreisigen Weinen bemerkbar. Im Gegensatz zu Zoll und Lieferkosten, die sich pro Gewichtseinheit niederschlagen und damit vor allem die günstigen Weine stark belasten. Der immer stärker werdende Franken und der schwächelnde Euro wiederum bewirken, dass früher eingekaufte Weine in der Schweiz nicht mehr dem aktuellen Kurs entsprechen und zu teuer erscheinen. Das wird sich mit dem neuen EU-Lager ändern, weil die Währung dann erst zum Zeitpunkt des Verbrauchs gewechselt wird und nicht schon zum Zeitpunkt des Einkaufs. Erstmals wird dieses System im Herbst-Katalog umgesetzt.
Haben Sie weitere Fragen? Schreiben Sie uns, vielen Dank.